Verbesserte Versorgung von Frauen mit Herzinfarkt

Verglichen mit Männern sterben Frauen häufiger an einem Herzinfarkt und haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, eine frühe invasive Behandlung zu bekommen. Gründe sind Unterschiede im Alter und in Begleiterkrankungen, die auch die Risikoabschätzung bei Frauen erschweren. Forschende in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz haben ein neues Vorhersagemodel entwickelt, das die personalisierte Versorgung von Frauen mit Herzinfarkt verbessert. Kürzlich versammelten sich Wissenschafter:innen auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Medizin, um die neuesten Fortschritte im globalen Kampf gegen Herzkrankheiten zu diskutieren.
Zu einem Herzinfarkt kann es kommen, wenn sich Blutgefäße verschließen, die den Herzmuskel mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Die Folge: Der betroffene Teil des Muskels stirbt ab. Die Pumpkraft des Herzens kann dadurch so sehr vermindert werden, dass wichtige Organe im Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden. Starke Schmerzen in der Brust zählen zu klassischen Anzeichen für einen Herzinfarkt, doch vor allem bei Frauen äußert sich ein Herzinfarkt oft weniger eindeutig als bei Männern.
Verbesserte Vorhersage
Frauen sterben verglichen mit Männern häufiger an einem Herzinfarkt. Auch die Symptome unterscheiden sich und werden bei Frauen oft falsch interpretiert. Im Gegensatz zu Männern, die meist einen schmerzhaften Druck auf der Brust mit Ausstrahlung in den linken Arm verspüren, führt ein Herzinfarkt bei Frauen häufig zu Bauchschmerzen und einem Ausstrahlen in den Rücken oder Übelkeit und Erbrechen. Deswegen werden die körperlichen Anzeichen bei Frauen oftmals nicht richtig erkannt. Eine falsche Einschätzung dieser Symptome oder ein zu spätes Handeln kann verhängnisvolle Folgen haben.
Im August des Vorjahres versammelten sich die weltweit führenden Wissenschafter:innen auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Medizin in Barcelona, Spanien, um die neuesten Fortschritte im globalen Kampf gegen Herzkrankheiten zu diskutieren. Unter anderem wurden Ergebnisse der bislang größten Studie Europas zum Akuten Koronarsyndrom ohne ST-Hebung (NSTE-ACS) präsentiert. Ein internationales Forschungsteam, angeführt vom Med Uni Graz-Absolventen Florian A. Wenzl von der Universität Zürich, hat in Zusammenarbeit mit Sereina Annik Herzog vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation der Med Uni Graz die Rolle des biologischen Geschlechts in der Risikoprädiktion und -stratifi kation untersucht. Die Studie beruht auf Daten von 420 781 Patient:innen aus ganz Europa und wurde im renommierten Fachjournal The Lancet publiziert.

Unterschiede im Risikoprofil
Die Studie in Kooperation mit King’s College London, Imperial College London, University College London und University of Zurich zeigt, dass sich Frauen und Männer in ihrem Risikofaktorprofil unterscheiden und etablierte Risikomodelle, die das derzeitige Patient:innenmanagement steuern, bei Frauen weniger genau sind. Forscherin Sereina Annik Herzog schildert die Erkenntnisse der Analyse: „Die Studie zeigt unter anderem, dass Risikomodelle, die das derzeitige Patient:innenmanagement steuern, bei Frauen weniger genau sind und potenziell die Unterbehandlung von Patientinnen begünstigen.“
Mithilfe von maschinellem Lernen ist es gelungen, einen verbesserten Risikoscore zu entwickeln, der geschlechtsspezifische Unterschiede im Risikoprofi l berücksichtigt und die Vorhersage der Sterblichkeit bei Frauen und Männern verbessert. Viele Forschende und Biotech-Unternehmen sind sich einig, dass künstliche Intelligenz und die Analyse von Big Data der nächste Schritt auf dem Weg zur personalisierten Patient:innenversorgung sind. Moderne Computeralgorithmen können aus großen Datensätzen lernen und genaue Vorhersagen über die Prognose einzelner Patient:innen treffen. Und diese sind wiederum der Schlüssel zu individualisierten Behandlungen. Florian Wenzl erklärt: „Unsere Studie läutet die Ära der künstlichen Intelligenz in der Behandlung von Herzinfarktpatient:innen ein. Wir hoffen, dass der Einsatz der neuen Risikobewertung derzeitige Behandlungsstrategien verfeinert, geschlechtsspezifische Ungleichheiten verringert und letztlich das Überleben insbesondere von Frauen mit Herzinfarkt verbessert.“
Bei einem Herzinfarkt ist jede Minute entscheidend, deswegen ist schnelles Handeln gefragt. Zudem gilt es auch, bekannte Riskikofaktoren – Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte, Stress, Übergewicht, Diabetes und Rauchen – zu vermeiden. Auch hier müssen geschlechtsspezifische Ursachen berücksichtigt werden, so wirkt sich Rauchen schwerwiegender auf die Herzgesundheit von Frauen aus als auf jene von Männern, auch die Einnahme der Pille stellt beispielsweise einen Risikofaktor dar.
Quelle: MEDitio 03/2022

























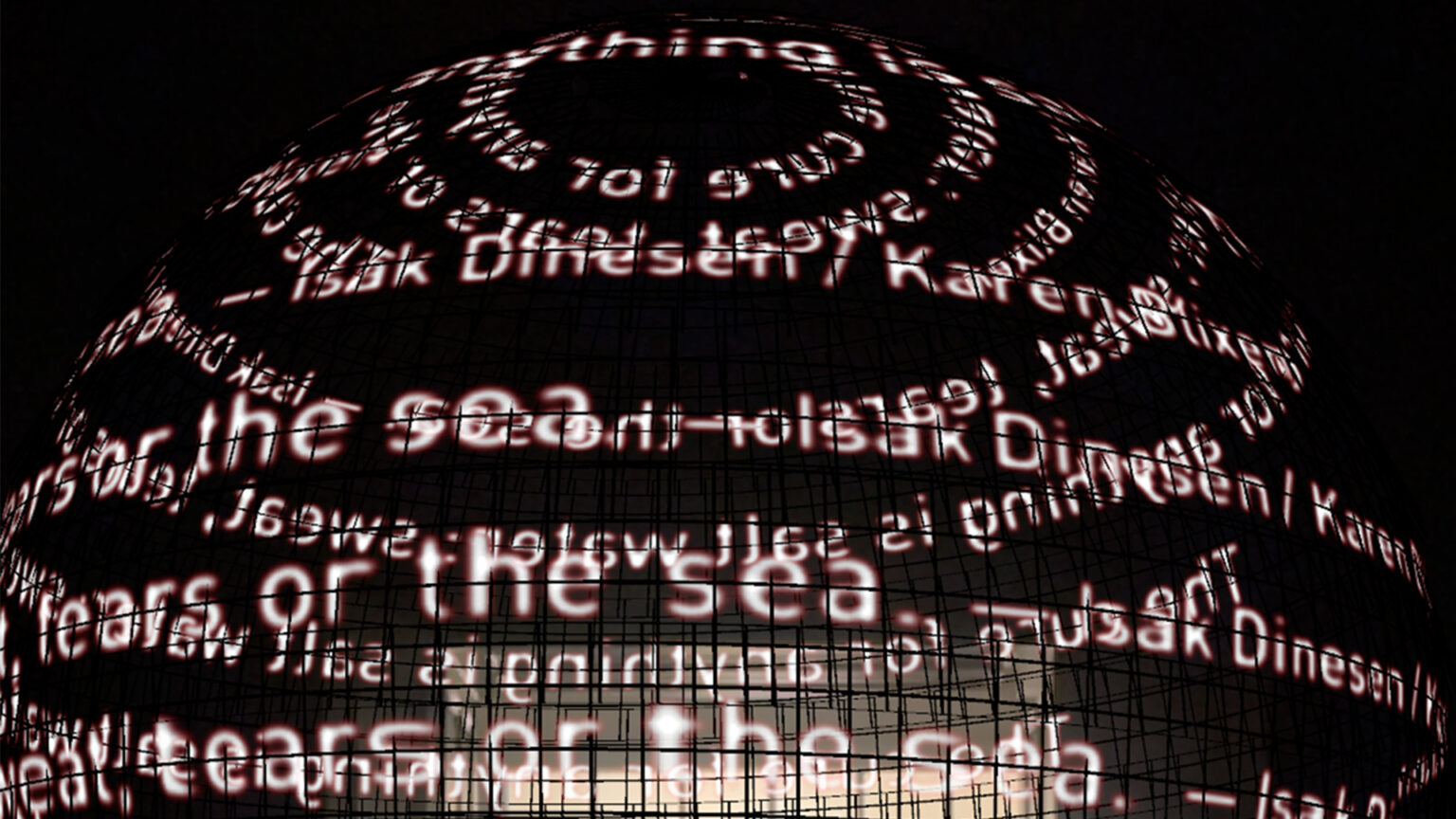












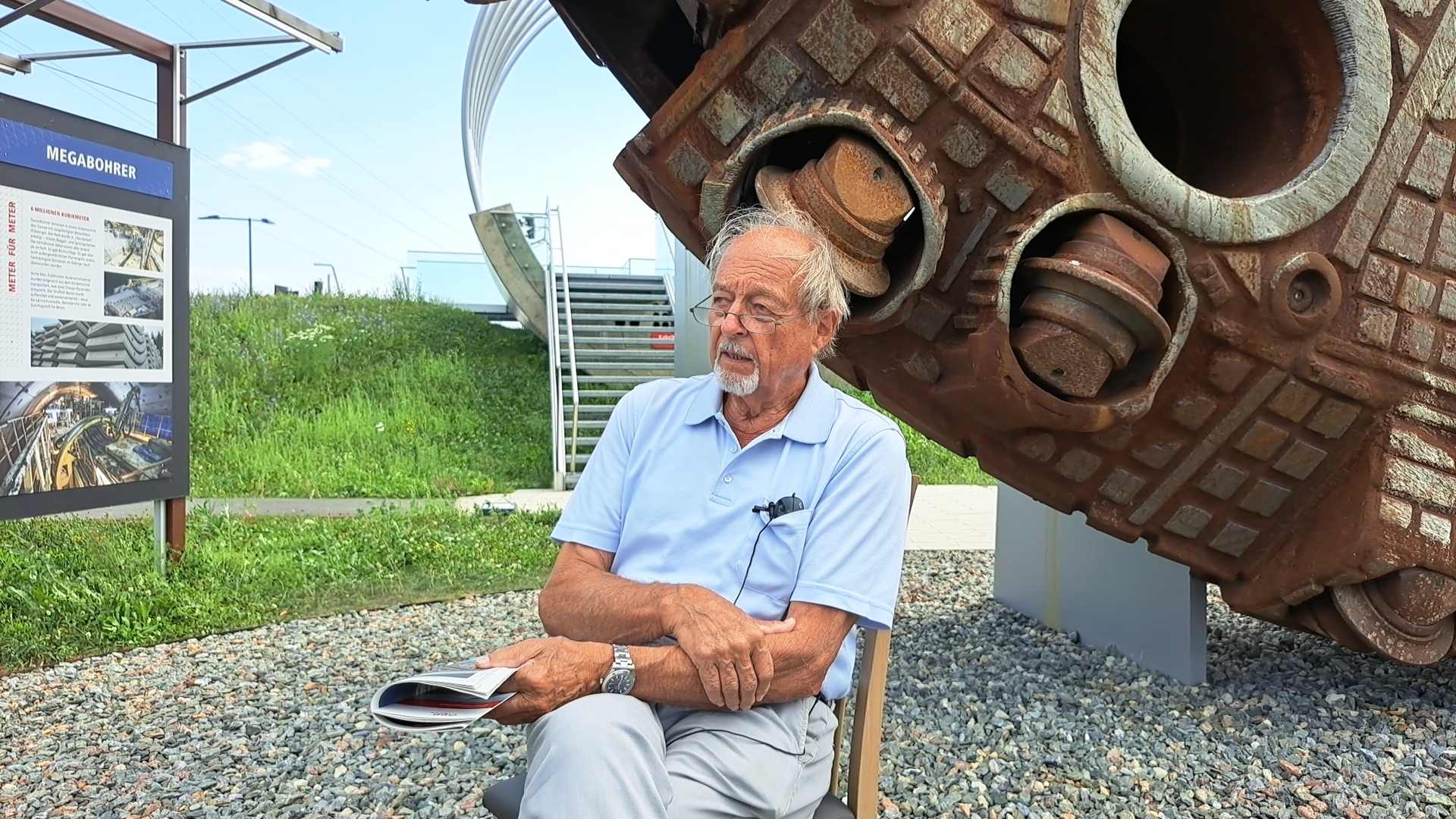






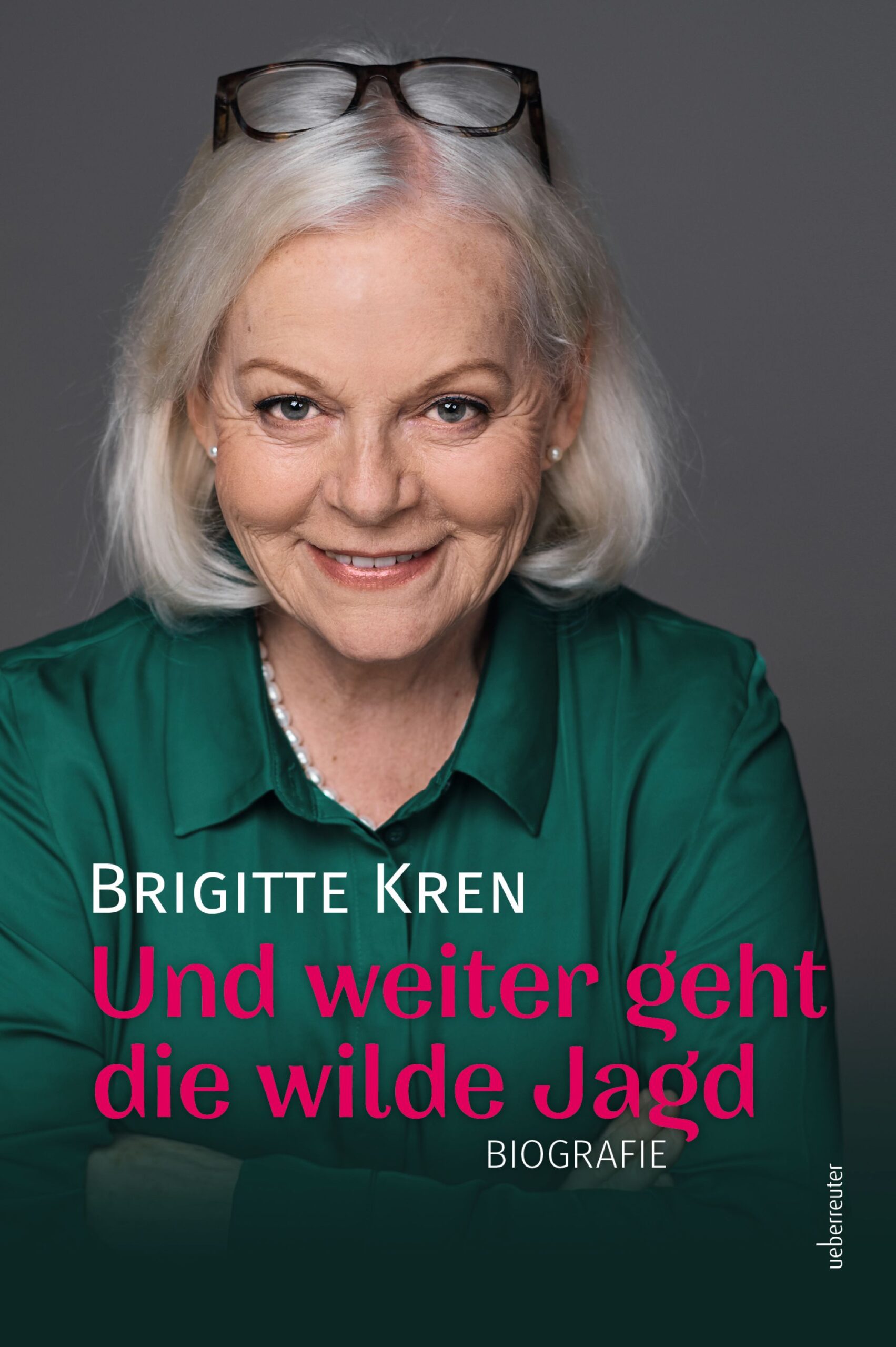
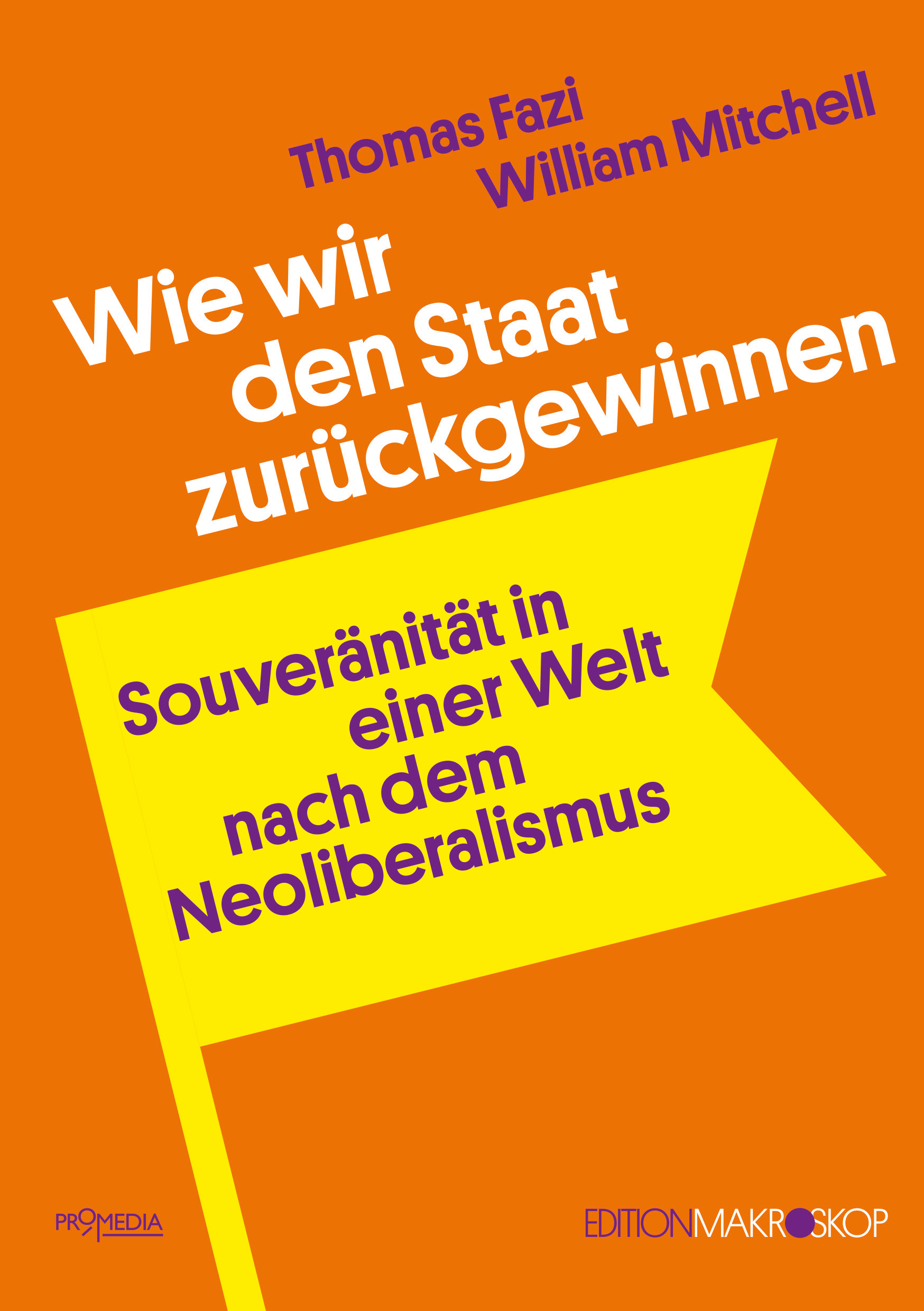
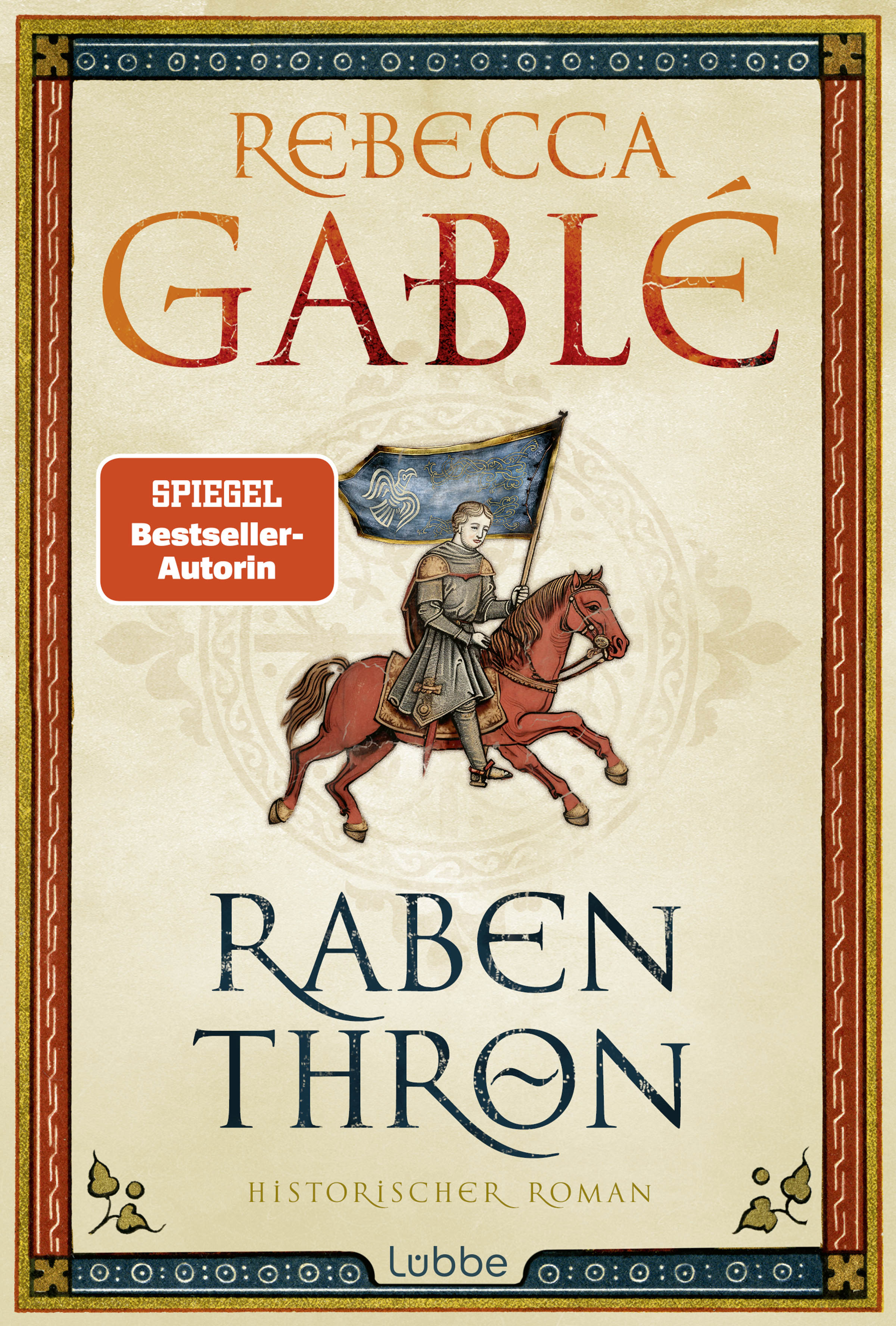
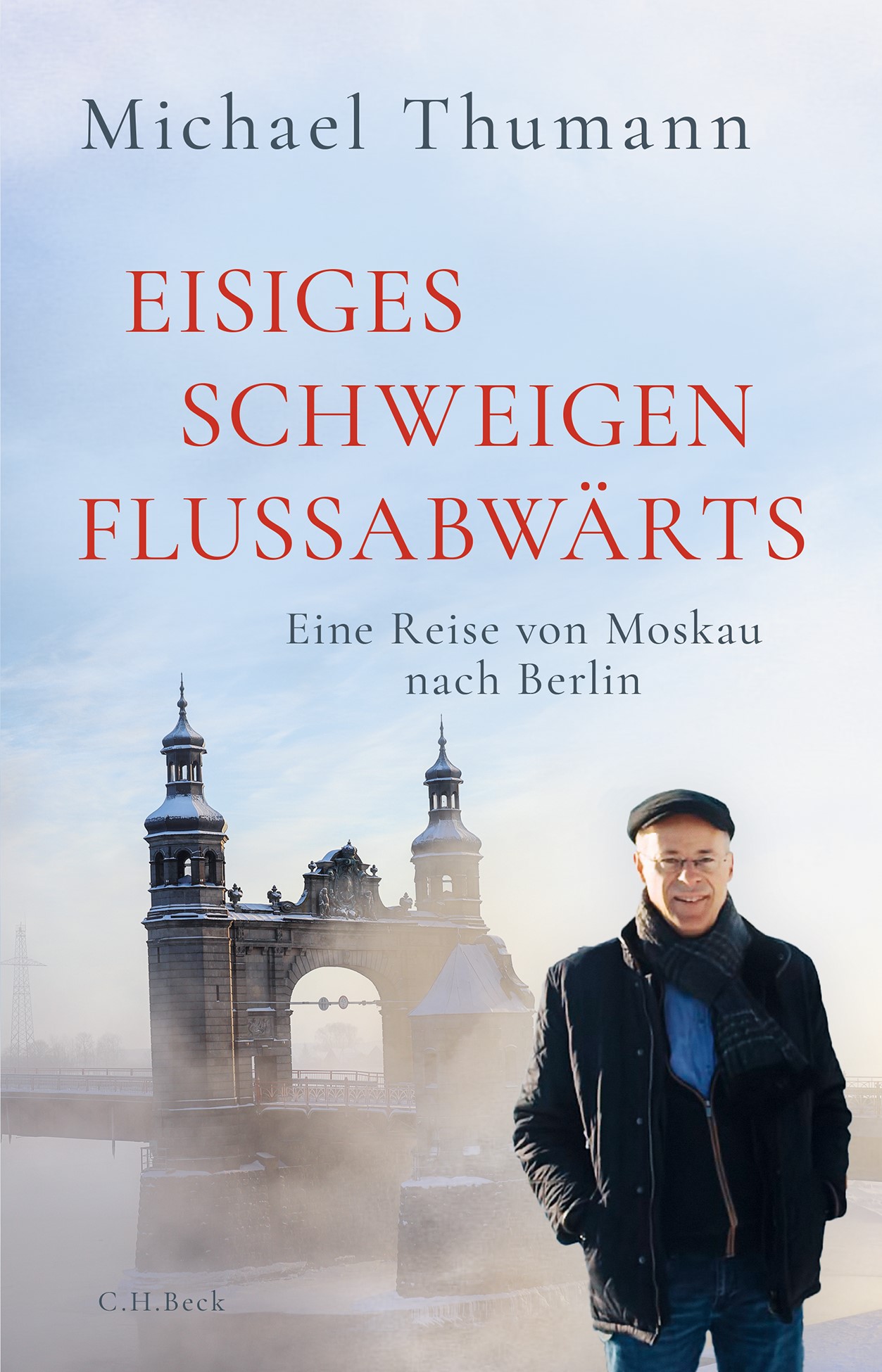









Sei der erste der kommentiert