Roboter in OPs unentbehlrich. Spektrum erweitert sich laufend.

Im November vor drei Jahren wurde am Uniklinikum Graz der erste „Da Vinci“ installiert, knapp zweieinhalb Jahre nach seiner Premiere bekam „Da Vinci“ Verstärkung durch ein zweites Gerät seiner Art. Seither sind die beiden Chirurgieroboter an fünf Tagen pro Woche im Einsatz: Eines der Geräte wird vollständig von der Urologie betrieben (fünf Tage pro Woche), das zweite nützen die Klinische Abteilung für Gynäkologie und die Klinische Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie gemeinsam.
Zu hundert Prozent ausgelastet und unentbehrlich
Beide Systeme sind voll ausgelastet. „Das zeigt, wie groß der Bedarf ist und dass die Entscheidung für diese Investition goldrichtig war“, sagt der KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Ulf Drabek. „Mit der Anmietung eines zweiten Da Vinci-Systems im März dieses Jahres konnten wir die Kapazitäten für unsere Patient:innen verdoppeln, das Behandlungsspektrum erweitern und die Versorgung damit auf ein sehr hohes Niveau heben. Patient:innen profitieren von den minimalinvasiven, schonenden Eingriffen durch geringeren Blutverlust, weniger Schmerzen, kleinere Narben und deutlich schnellerer Genesung.“
Der zweite „Da Vinci“ wurde am Uniklinikum Graz jedenfalls mit offenen Armen empfangen, was auch die Zahlen widerspiegeln. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 sind schon gleich viele Eingriffe robotergestützt erfolgt wie im gesamten Jahr davor, nämlich 415. Auf der Urologie waren es mit 265 OPs sogar mehr als im gesamten Jahr davor.


Das Haupteinsatzgebiet der robotergestützten Chirurgie ist – international wie auch in Graz – die Urologie. Hier assistiert „Da Vinci“ an fünf Tagen pro Woche bei einer ganzen Spannbreite von Eingriffen. Der häufigste Eingriff ist die Operation eines Prostatakarzinoms, dem häufigsten Tumor bei Männern (6.000 Neudiagnosen in Österreich pro Jahr). „Bei der Prostataentfernung, ob mit oder ohne Entfernung der Beckenlymphknoten, setzen wir Da Vinci absolut routinemäßig ein“, erzählt Univ.-Prof. Dr. Sascha Ahyai, Klinikvorstand der Univ.-Klinik für Urologie des LKH-Univ. Klinikum Graz.
Der zweithäufigste Eingriff auf der Urologie ist die Nierenteilresektion, also die Entfernung des von einem Tumor betroffenen Nierenbereichs mit Erhalt der Niere. Hinzu kommt eine große Bandbreite zwischen Nierenbeckenplastik und Blasensenkungen bis hin zu seltenen OPs des Peniskarzinoms oder Fistel-OPs, wobei sich das Spektrum der robotergestützten Operationen laufend erweitert.

Wo liegen „Da Vincis“ Schwächen?
Nicht einsetzbar sind Chirurgieroboter bisher in der Akutchirurgie, bei jeder Form von Traumata und wann immer Infektionen oder ein Eitergeschehen im Spiel sind. „Mir ist wichtig, dass den Patient:innen klar ist, dass diese Systeme absolut nichts alleine machen. Jede kleinste Aktion ist vom Chirurgen gesteuert, einzig und allein das etwaige Zittern der chirurgischen Hand wird automatisch herausgefiltert“, sagt Univ.-Prof. Dr. Ahyai. „Wir haben am Uniklinikum die für Patient:innen vorteilhafte Situation, dass alle Roboterärzt:innen auch offen operieren können. In vielen Kliniken können sie nur das eine oder das andere. Ein Wechsel von der Konsole hin an den OP-Tisch ist so bei Bedarf jederzeit sofort möglich“, ergänzt KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark.
Investitionen in topmoderne Operationstechnik
Welches Resümee lässt sich zur modernen Roboterchirurgie ziehen? „Unser Anspruch ist es, unseren Patient:innen immer die bestmögliche medizinische Versorgung zu garantieren. Durch ihr enormes Potenzial, insbesondere bei der Präzision und gleichzeitiger Minimalinvasivität, sind OP-Roboter die beste Grundlage dafür, dass das große chirurgische Know-how unserer Ärzt:innen perfekt unterstützt wird“, bekräftigt der KAGes-Finanzvorstand Ulf Drabek. „Deshalb investieren wir auch weiterhin in neue Technologien, die sicherstellen, dass unsere Patient:innen von den Fortschritten in der Medizin profitieren können.“ Und die robotischen Systeme entwickeln sich rapide weiter. In der Zukunft werden auch komplizierte Operationen über einen einzigen minimalinvasiven Zugang möglich sein, während es heute noch vier kleine Schnitte braucht.
























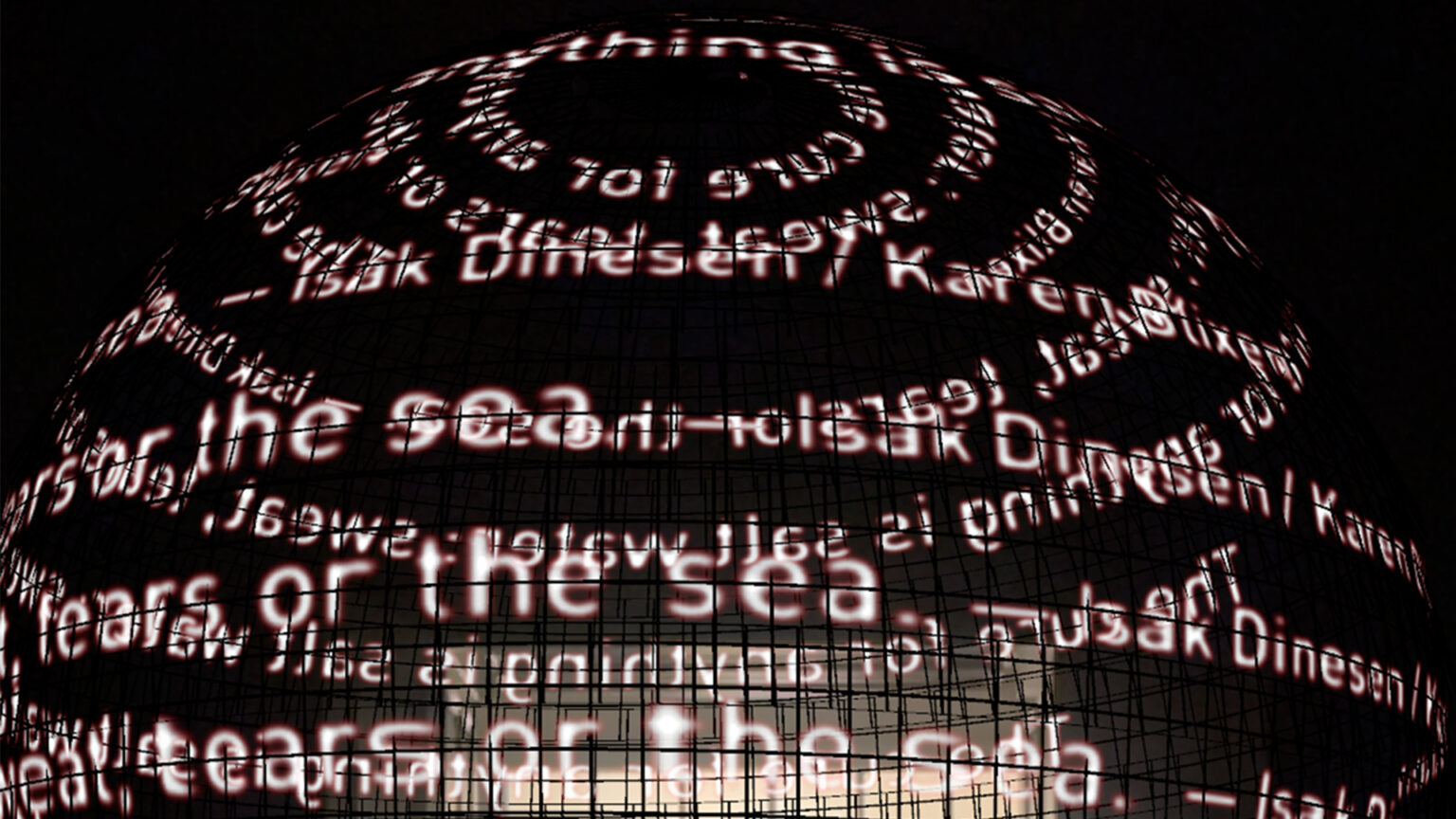











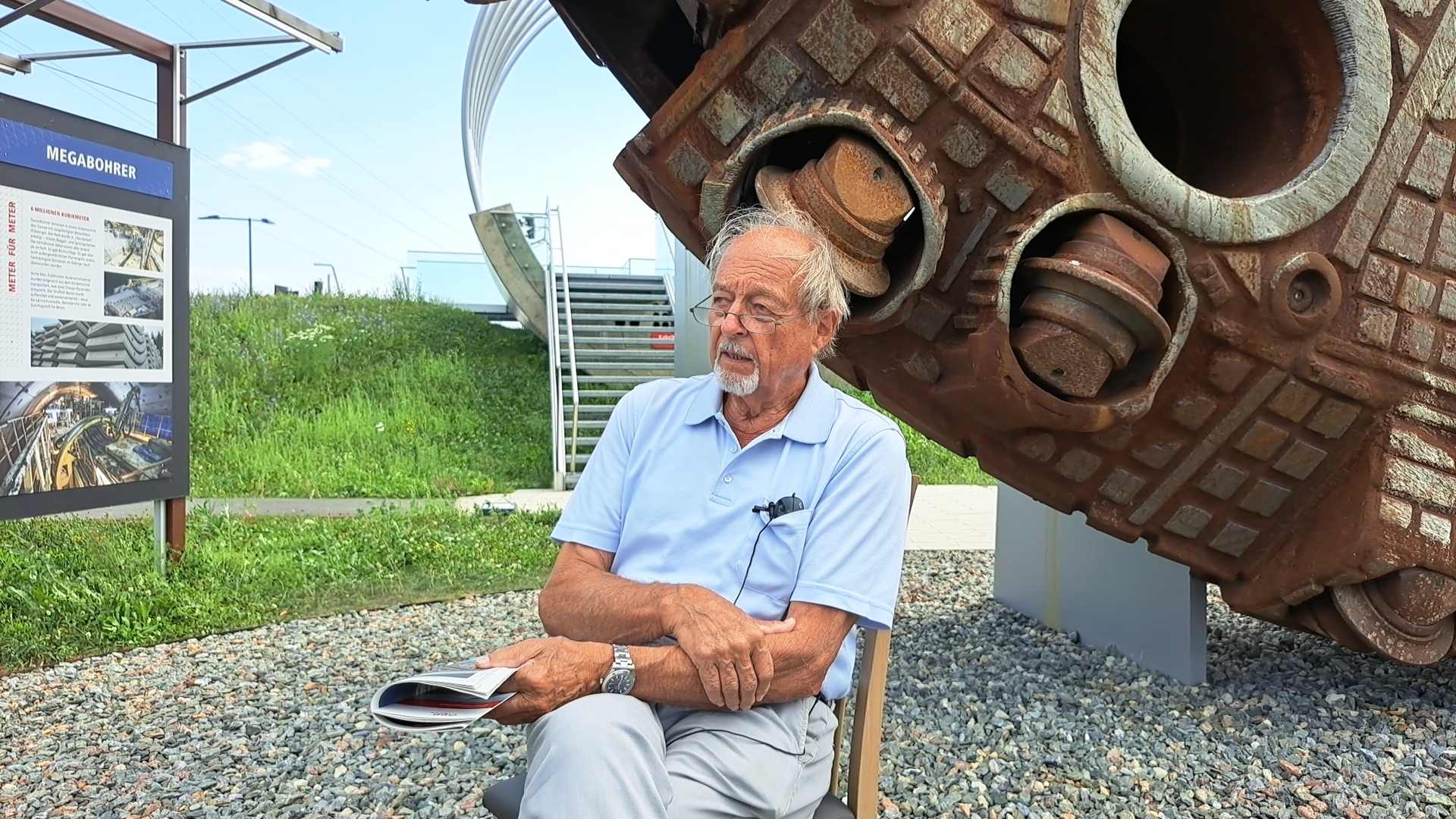






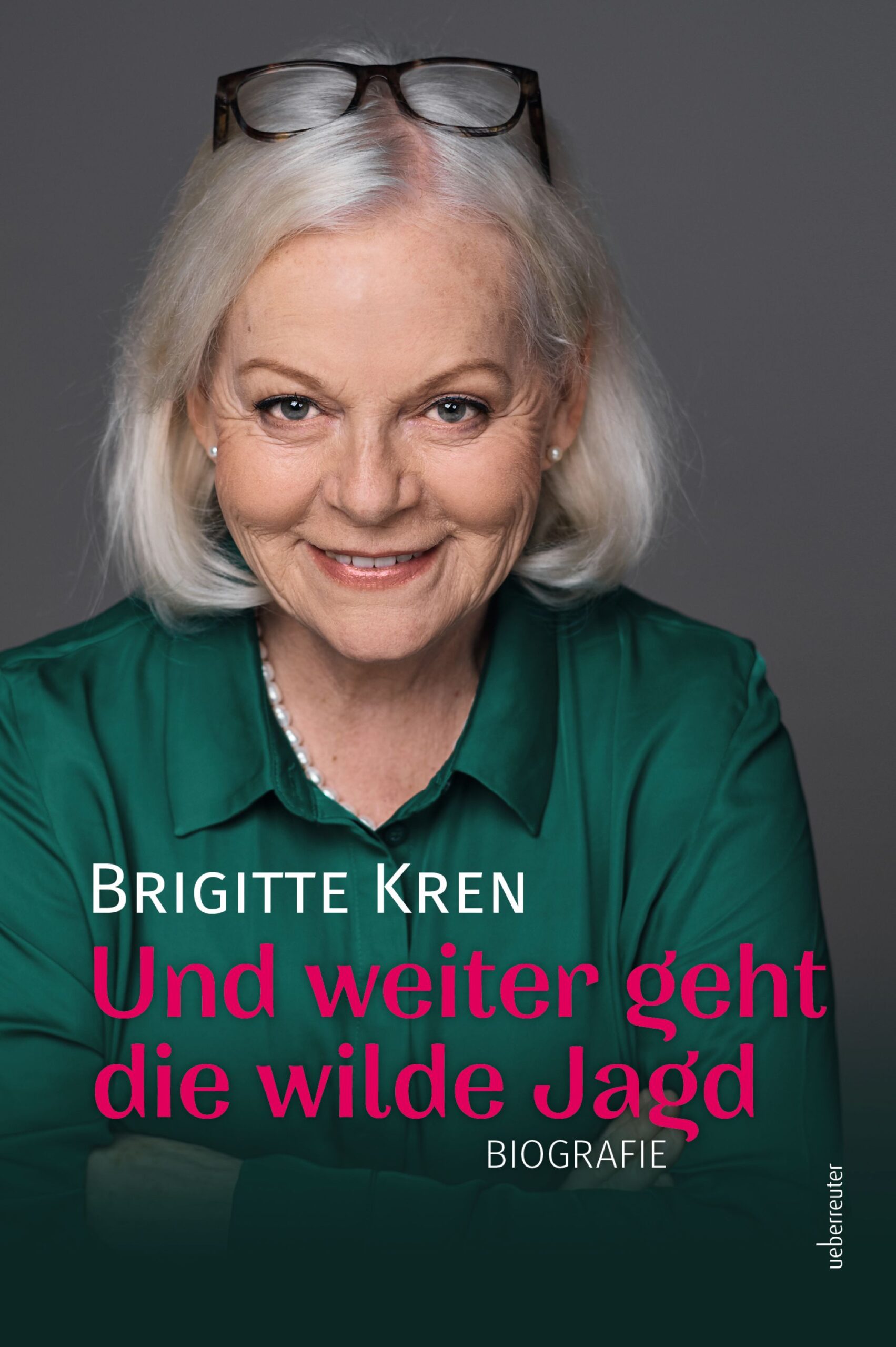
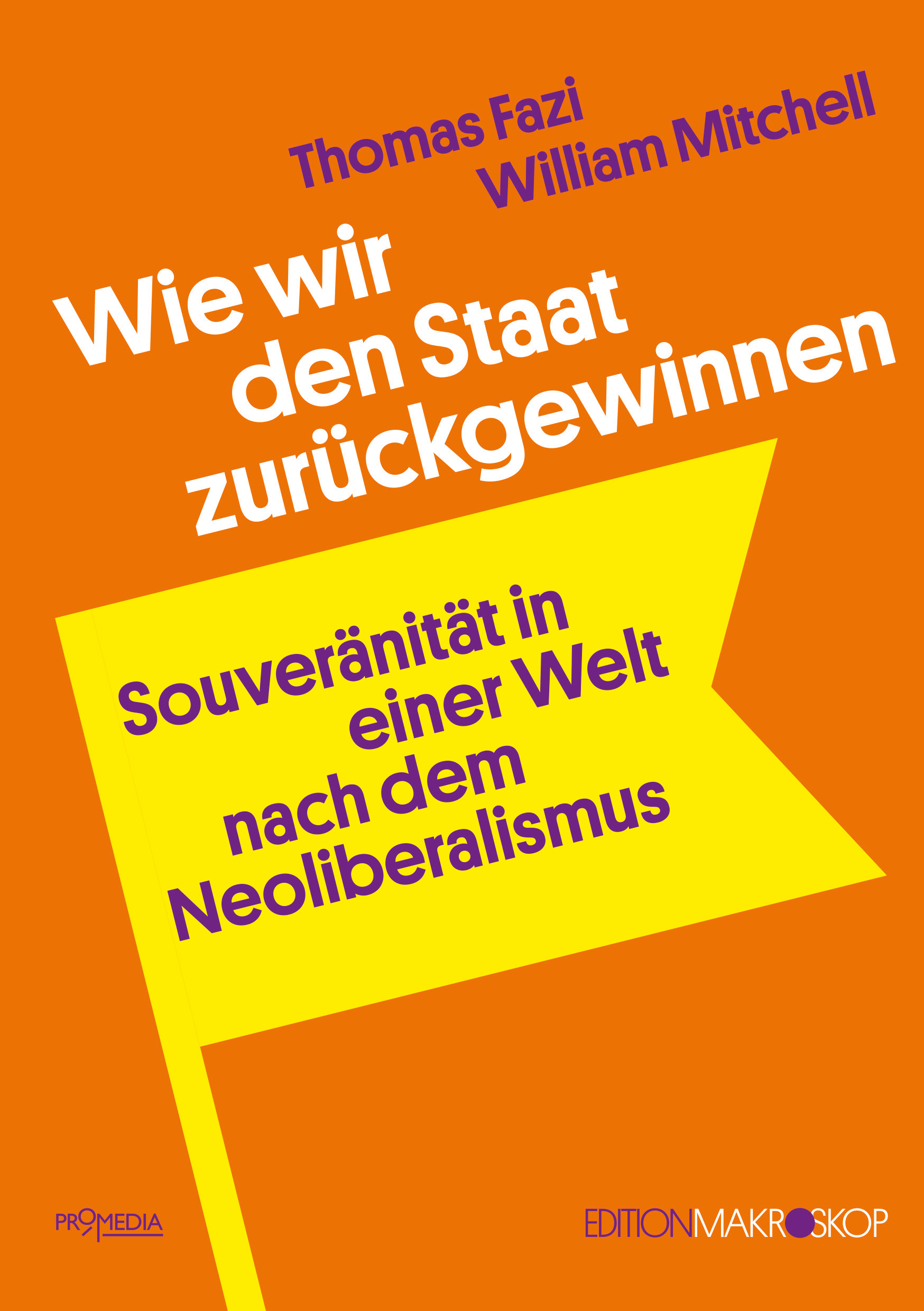
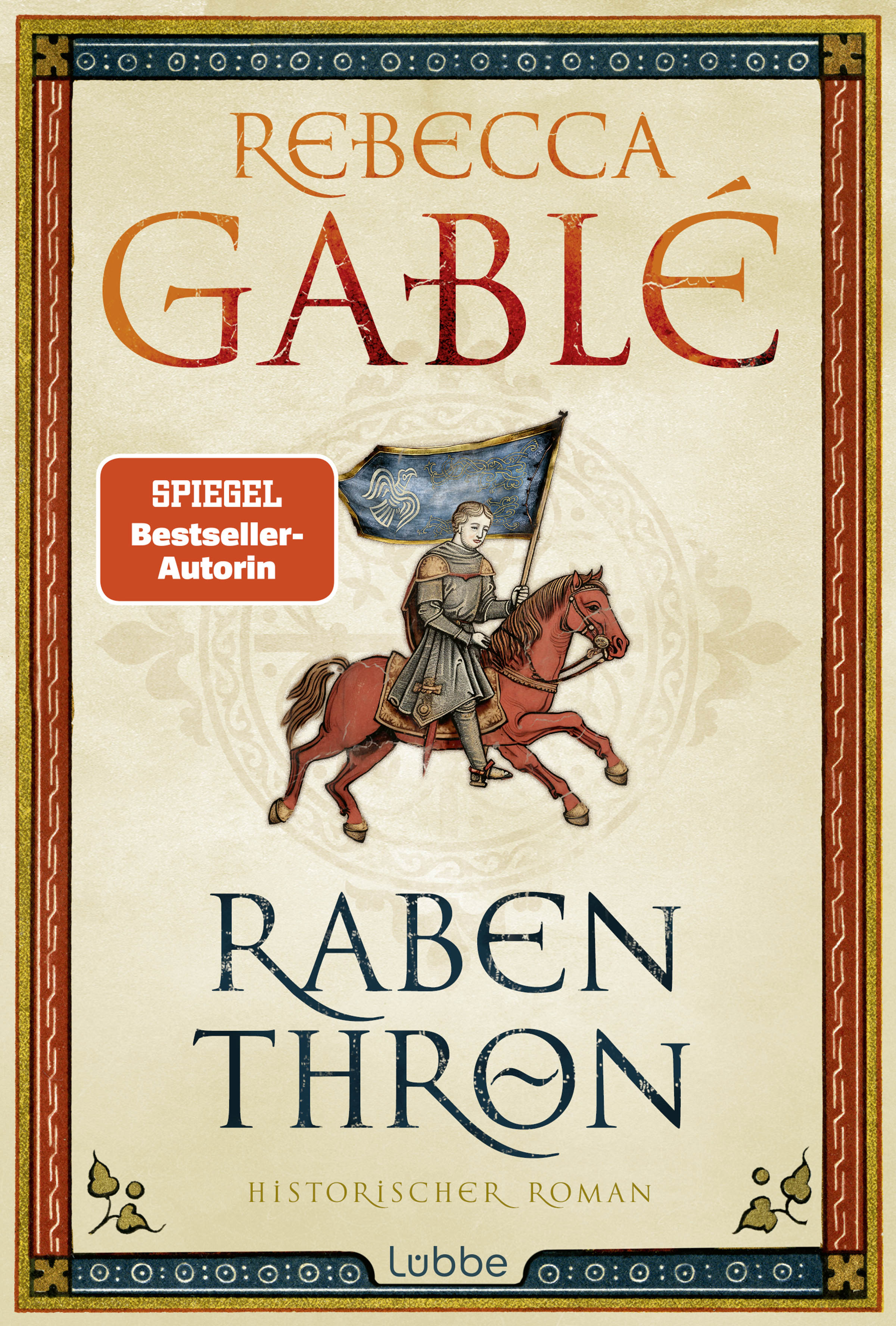
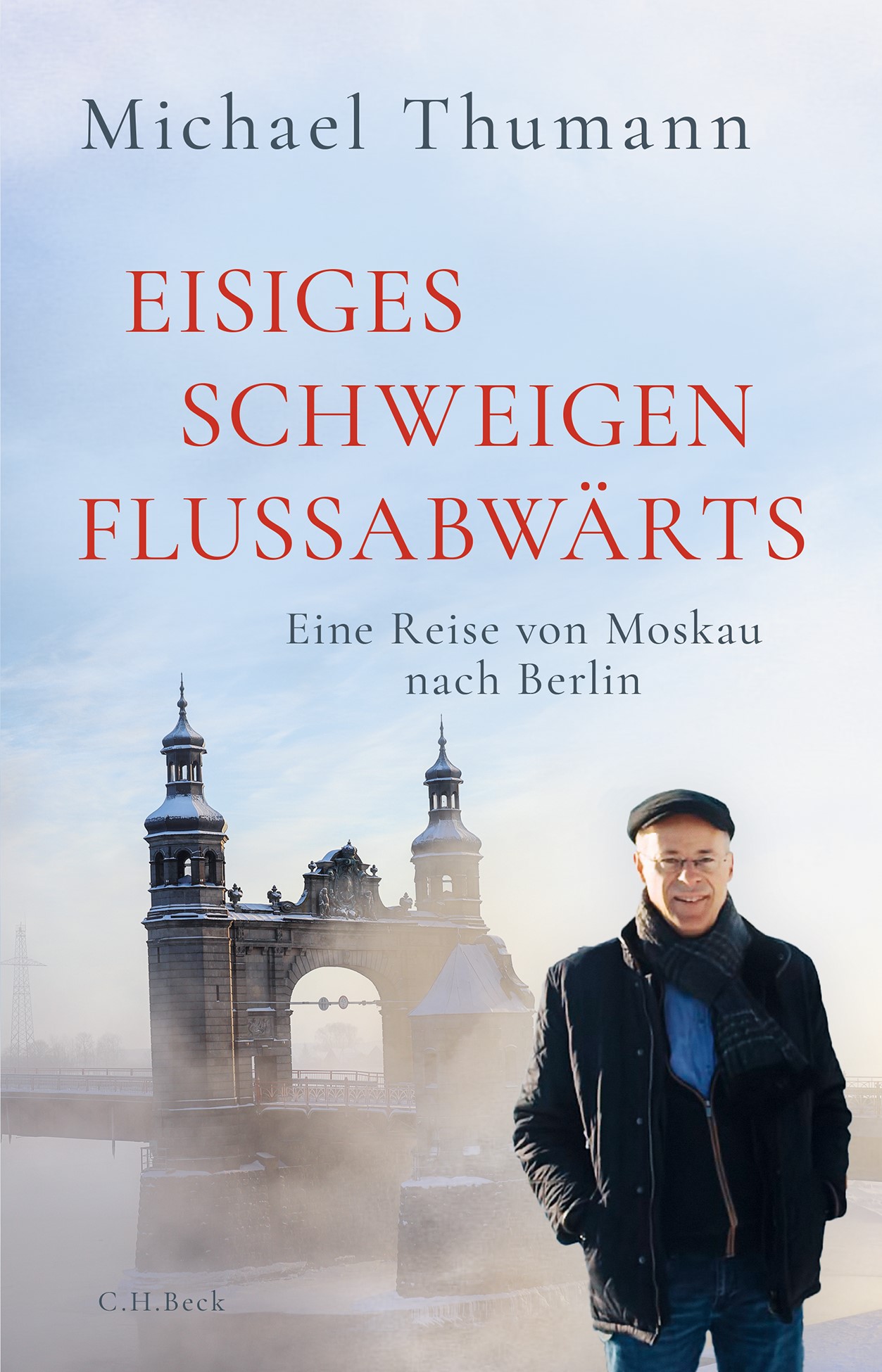









Sei der erste der kommentiert