Bewährtes Muster


Auch die Lügen des emeritierten Papstes Benedikt im Zusammenhang mit ihm bekannten, abscheulichen Missbrauchsfällen sind ein Beispiel dafür. Der emeritierte Papst leugnet, davon gewusst zu haben, dass in seiner Zeit als Kardinal in München er über Missbrauchsfälle informiert war, die an Kindern und Jugendlichen begangen worden sind. Daher hätte er auch nicht einschreiten können. Erst das jüngste Gutachten überführt ihn der Lüge. Erst jetzt bequemte er sich zum Eingeständnis, darüber gewusst zu haben. Aber keine Entschuldigung.
In Österreich nicht anders
In Statements von Kardinal Christoph Schönborn zum Kinderschänderskandal in München erklärt dieser sinngemäß, in Österreich wären aber derartige Situationen und Probleme in der Vergangenheit nicht zuletzt durch die „Klasnic-Kommission“ transparent in Angriff genommen worden. Leider nicht die volle Realität.
Es dauerte Jahre
Der Missbrauchsskandal um den Wiener Kardinal Hans Hermann Groër bleibt auch bis heute noch immer ein Paradebeispiel für den Umgang der Kirche mit Sexualstraftätern in ihren Reihen, die lange Zeit dicht geschlossen gehalten wurden, um mutmaßliche Kinderschänder zu schützen. Erst wenn Betroffene sexueller Gewalt mit ihrer Leidensgeschichte an die Öffentlichkeit gehen und der Druck durch Medienberichte so stark wird, dass ein Leugnen nicht länger aufrechtzuerhalten ist, reagiert die Amtskirche.
Dabei hätte die katholische Kirche in Österreich vor 27 Jahren, also bereits im Jahr 1995, zur weltweiten Vorreiterin in Sachen Aufklärung von Missbrauchsfällen in ihren Reihen werden können. Sie entschied sich aber dafür, „einen der größten Knabenschänder Niederösterreichs“, wie ihn Michael Imlau, ein von Groër geweihter deutscher Priester, bezeichnet, zu decken und seine Opfer zu diffamieren.


Kardinal am Pranger
Es war der 26. März 1995, als die Titelgeschichte des Nachrichtenmagazins Profil für ein Beben in der katholischen Kirche sorgte. „Groër hat mich sexuell missbraucht“, stand auf der Titelseite zu lesen. Josef Hartmann, ein Ex-Zögling Groërs in dessen Zeit als Lehrer im Knabenseminar Hollabrunn, hatte berichtet, als Bub Opfer von Groërs sexuellen Übergriffen geworden zu sein. Ein katholischer Geistlicher, ein Kardinal, stand wegen sexueller Gewalt am öffentlichen Pranger. Die Welt schaute gebannt auf Wien, die Zahl der Kirchenaustritte nahm rasant zu. Knapp 44.000 Personen haben in Österreich bis Jahresende 1995 der katholischen Kirche den Rücken gekehrt, das ist eine Steigerung um ein Viertel im Vergleich zu 1994. Die Hebel der Macht wurden in Bewegung gesetzt. Andreas Khol, damals Klubobmann der ÖVP, wollte die Veröffentlichung des Profil-Berichts noch im Vorfeld durch eine gerichtliche Beschlagnahmung verhindern. Doch sein Versuch scheiterte ausgerechnet an Groër selbst, der sich weigerte, den Beschlagnahme-Antrag zu unterzeichnen. Er schwieg zur Causa. Dafür meldete sich der damalige Raiffeisen-Chef Christian Konrad, einer der Eigentümervertreter des Profil, lautstark zu Wort, wie sich Josef Votzi, einer der Autoren der Geschichte, erinnert: „Wann des net hoit, fliagts alle drei.“ Die „drei“ waren die beiden Autoren der Groër-Story, Chefredakteur Votzi und Herausgeber Hubertus Czernin, sowie Chefredakteur Herbert Lackner.
Die Kirche mauert
Die Geschichte hat gehalten. Andere zogen aus, um Groër zu verteidigen. Christoph Schönborn, damals noch Weihbischof in Wien, später dann und bis heute der Nachfolger von Groër als Kardinal, sagte im ORF-Interview: „Er schweigt zu diesen Vorwürfen, denn, ich glaube ich kann ihn hier verstehen, es ist die einzige Antwort auf solche diffamierenden, infamen Beschuldigungen, wie sie hier gegen ihn erhoben werden.“ Wenige Tage später legt der konservative St. Pöltner Bischof Kurt Krenn bei Robert Hochner in der „Zeit im Bild 2“ nach. Er verharmlost die Vorwürfe als „Hollabrunner Bubengeschichten“. Er schwärmt von Groërs „Noblesse“ und denunziert die Opfer – mittlerweile hatten sich weitere Betroffene gemeldet – als „kranke Seelen“, die sich möglicherweise falsch erinnerten.
Der Kardinal als Kinderschänder zog weltweit mediale Aufmerksamkeit auf sich. Groër trat am 6. April 1995 als Vorsitzender der österreichischen Bischofskonferenz zurück. In einer Aussendung ließ er tags darauf wissen, dass er „Inhalt und Gestalt der gegen mich getätigten Diffamierung und vernichtenden Kritik“ ausdrücklich zurückweise.

Es dauerte drei Jahre
Erst im Jahr 1998, also drei Jahre nach Auffliegen der Affäre, konnten sich die kirchlichen Würdenträger – die Bischöfe Christoph Schönborn, Johann Weber, Georg Eder und Egon Kapellari – dazu durchringen, den zahlreichen Missbrauchsopfern und nicht dem Täter Glauben zu schenken. Sie erklärten, dass die Vorwürfe gegen Groër „im Wesentlichen zutreffen“. Groër selbst wurde nie angeklagt. Er starb am 24. März 2003.
Danach kehrte bis zum Jahr 2010 „Ruhe“ ein, sieht man Kinderporno- und Homosexuellen-Skandal im Priesterseminar St. Pölten ab. Vorwürfe bezüglich roher Gewalt und sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen der katholischen Kirche brachen sich Bahn. Stiftsgymnasien, katholische Kinderheime, Nonnenklöster, Pfarren … Hunderte Betroffene aus allen institutionellen Bereichen sprachen erstmals über die Pein und ihre Peiniger. Die Kirchenaustritte schossen in bis dahin ungeahnte Höhen (87.000 Personen bis Jahresende, ein Plus von 64 Prozent gegenüber 2009). Zahlen aus anderen Ländern, die schon früher mit Missbrauchsvorwürfen gegen Kleriker konfrontiert worden waren, ließen die Alarmglocken schrillen: Das Bistum Los Angeles hatte im Jahr 2007 insgesamt 508 Betroffene mit 500 Millionen Euro entschädigt. Der Staat Irland und die irische katholische Kirche hatten 2009 Entschädigungen von mehr als einer Milliarde Euro ausbezahlt.
Es kam zur Installierung einer Kommission für die Aufarbeitung dieser Vorwürfe. Kardinal Schönborn bat die ehemalige steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic, den Vorsitz zu übernehmen. Diese sagte unter der Bedingung zu: „Ja, aber nur, wenn uns niemand dreinredet.“
Finanzhilfe für Opfer
Die Kommission entwarf ein Modell, wie man die Gewalt-Opfer seitens der Kirche entschädigen kann. Der Rahmen der finanziellen Hilfe erstreckt sich von 5.000 bis 25.000 Euro sowie in die Finanzierung von Therapiestunden. Auf Verjährung im gesetzlichen Sinn wird bei der Anerkennung von Ansprüchen verzichtet. Dieses Modell wurde noch im Jahr 2010 von der Stadt Wien und später in ähnlicher Form von anderen Kommunen übernommen, um Betroffene von Gewalt in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt zu entschädigen.
Quellen: Klipp-Archiv und Addendum-Zeitung (https://www.addendum.org/missbrauch/groer/)
































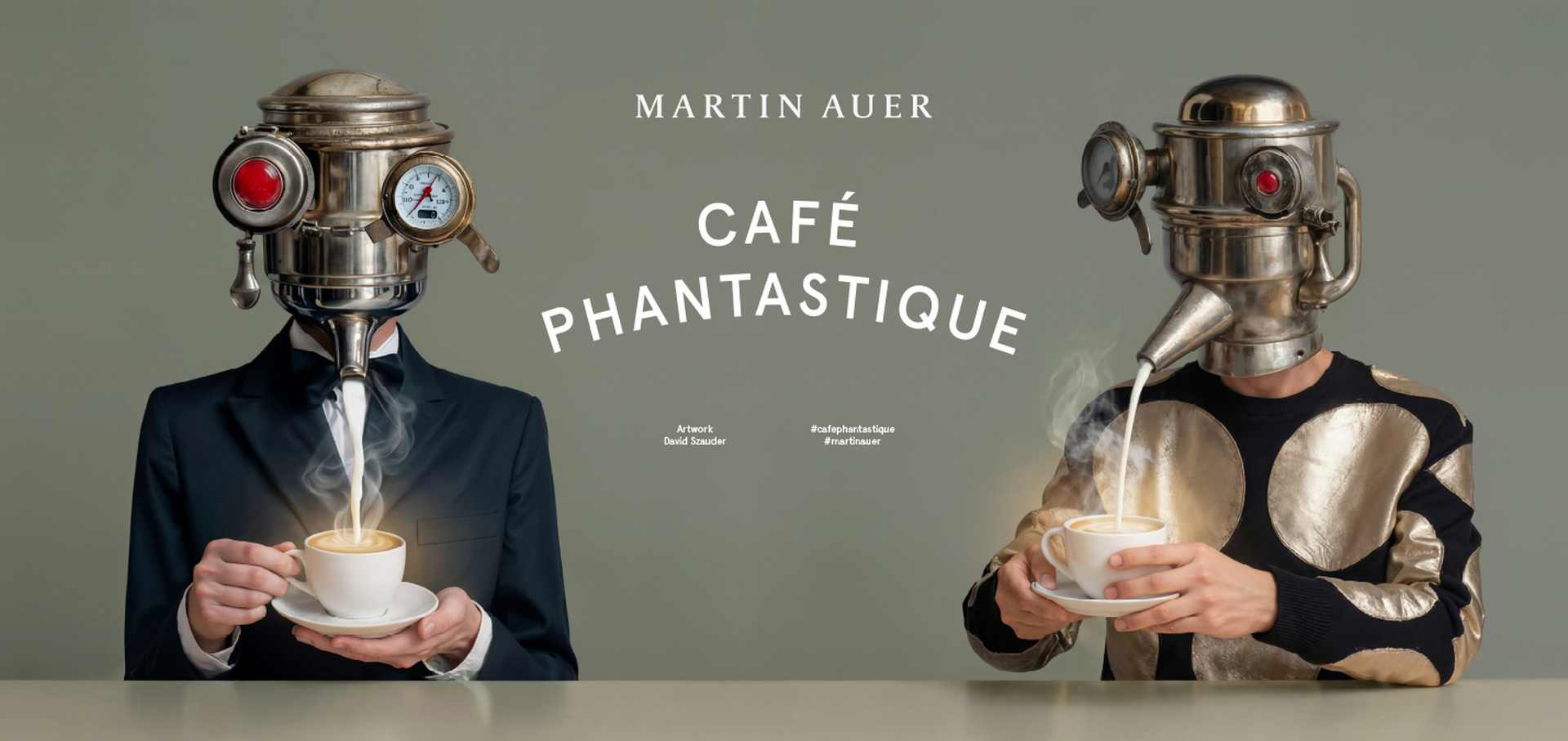



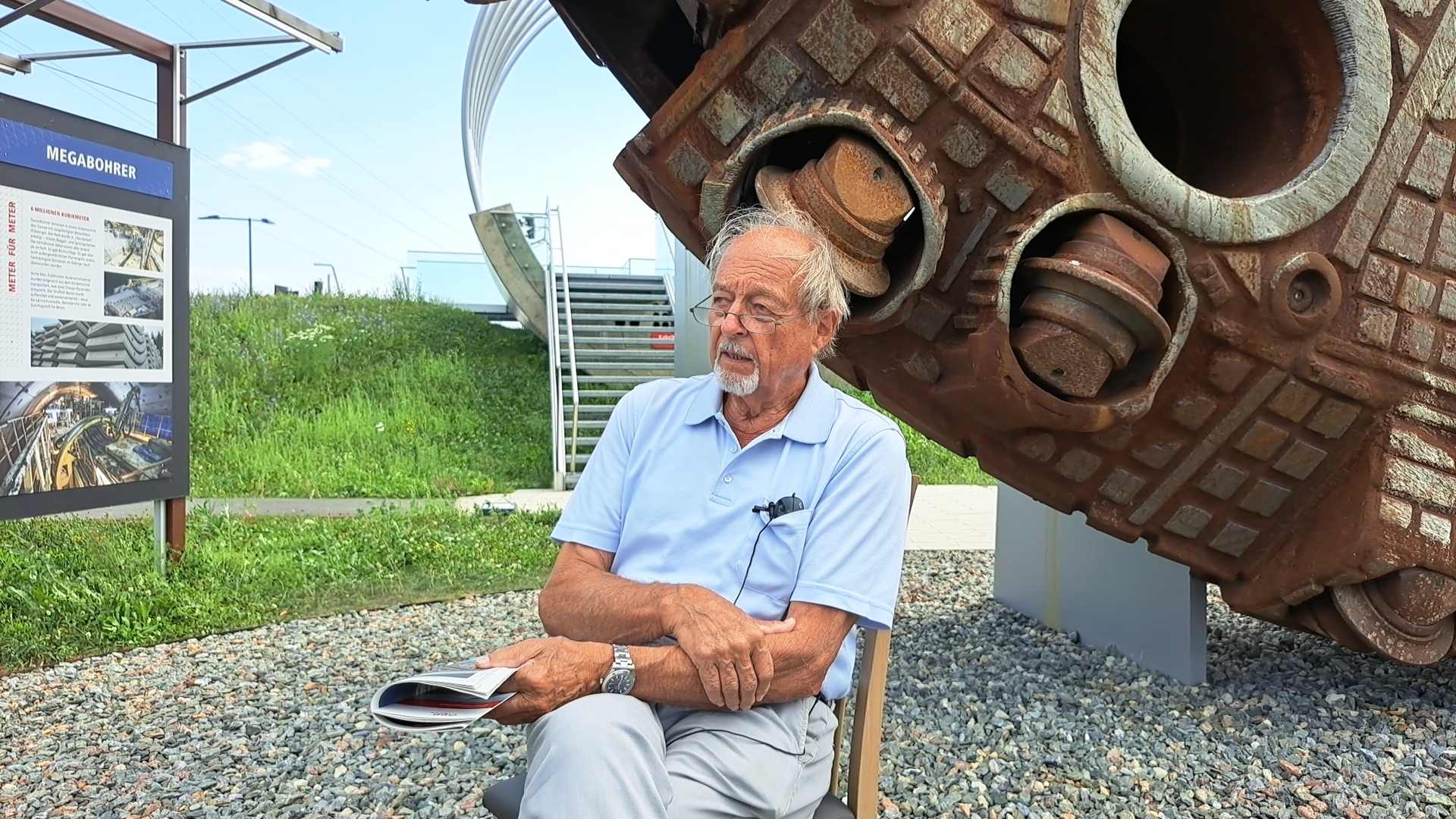





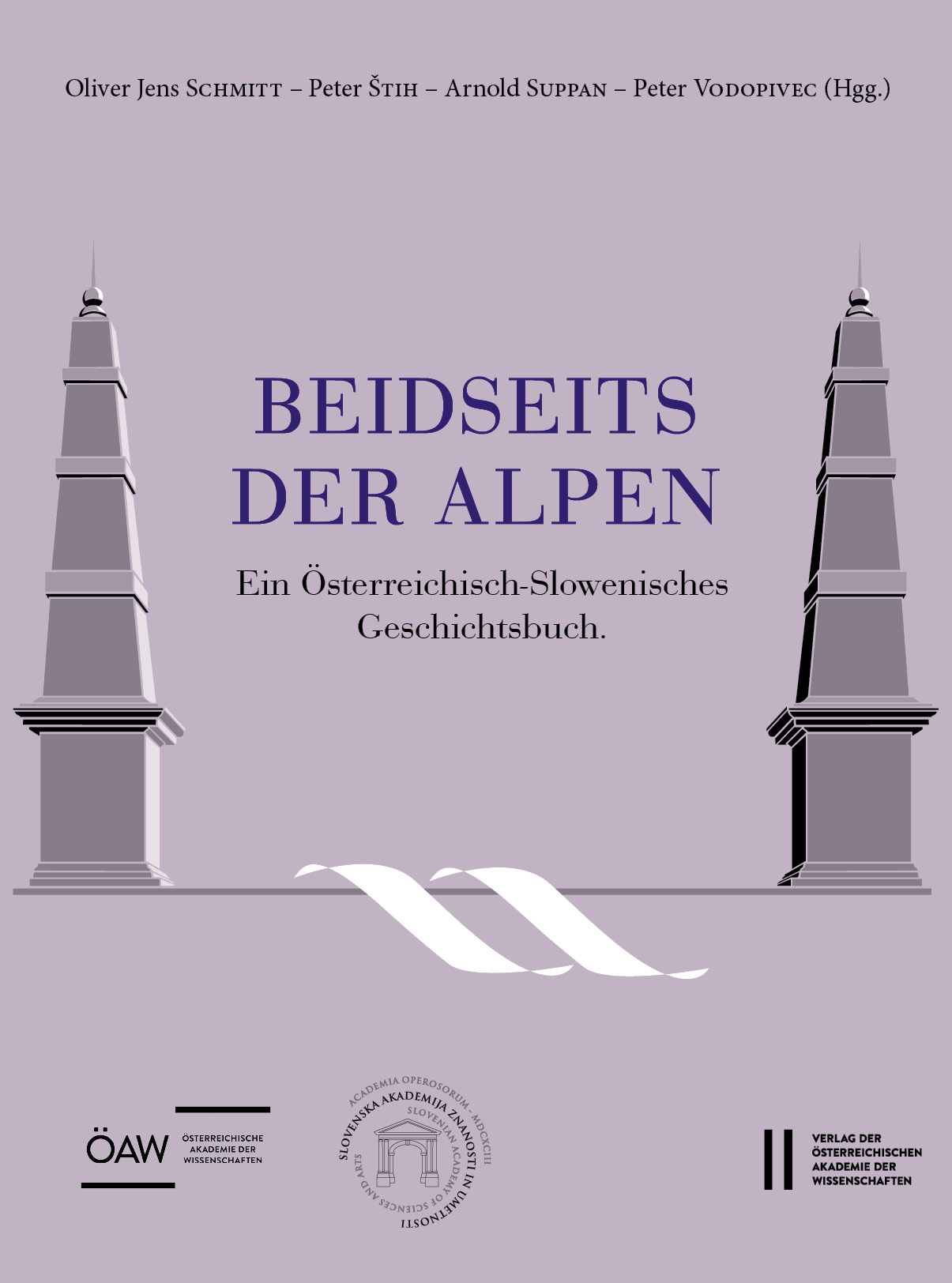
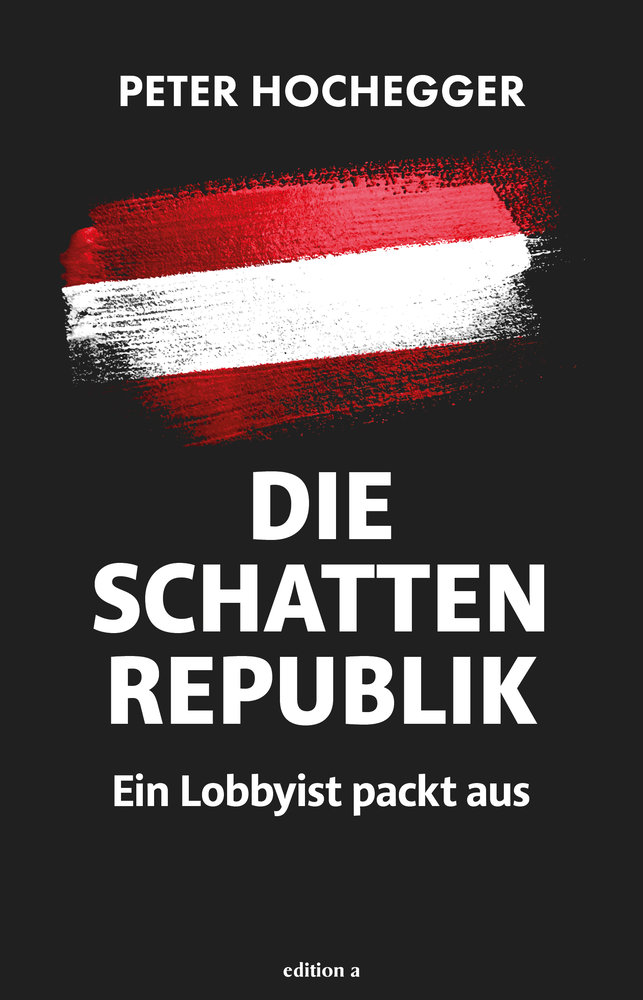
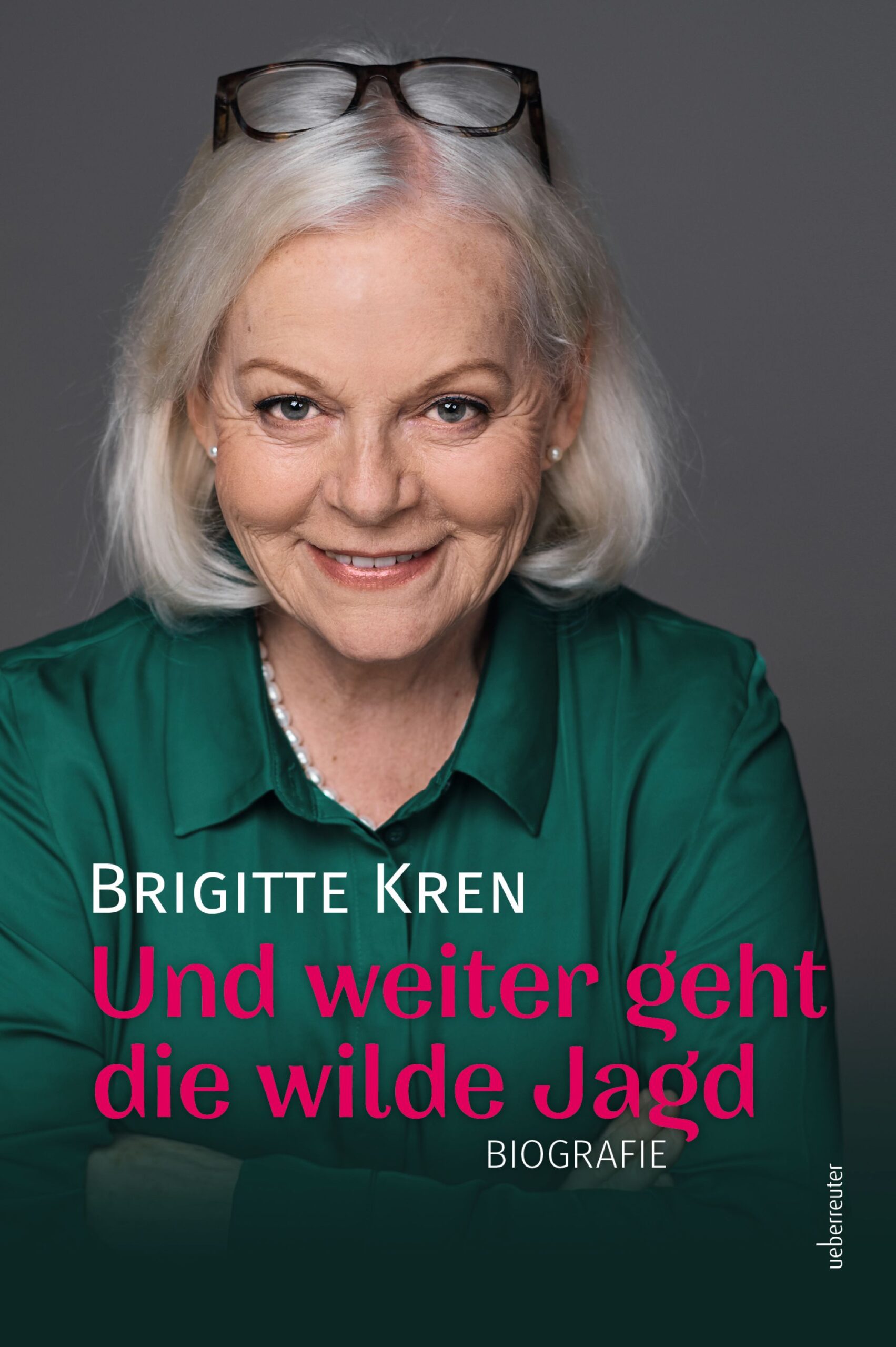
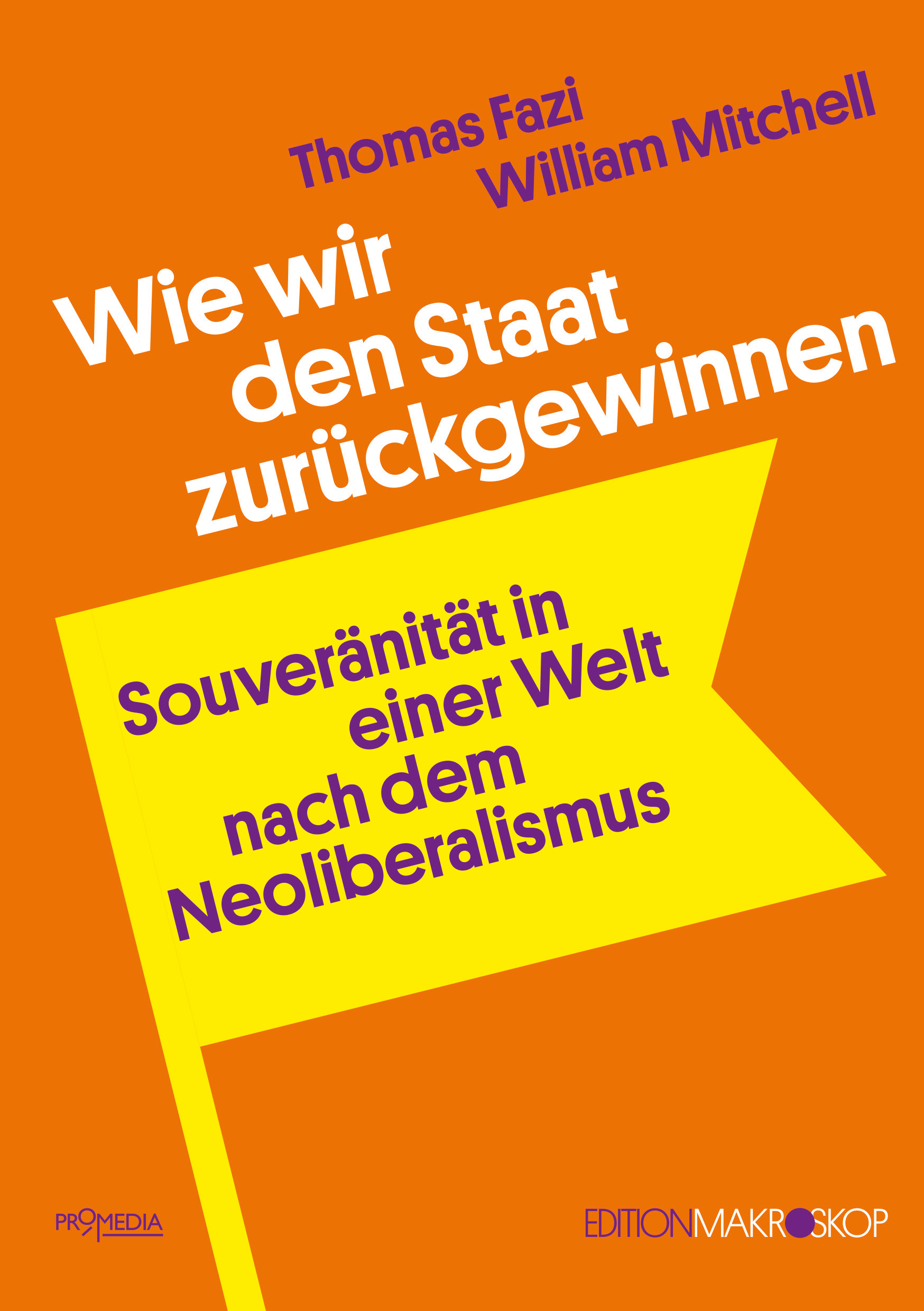









Sei der erste der kommentiert